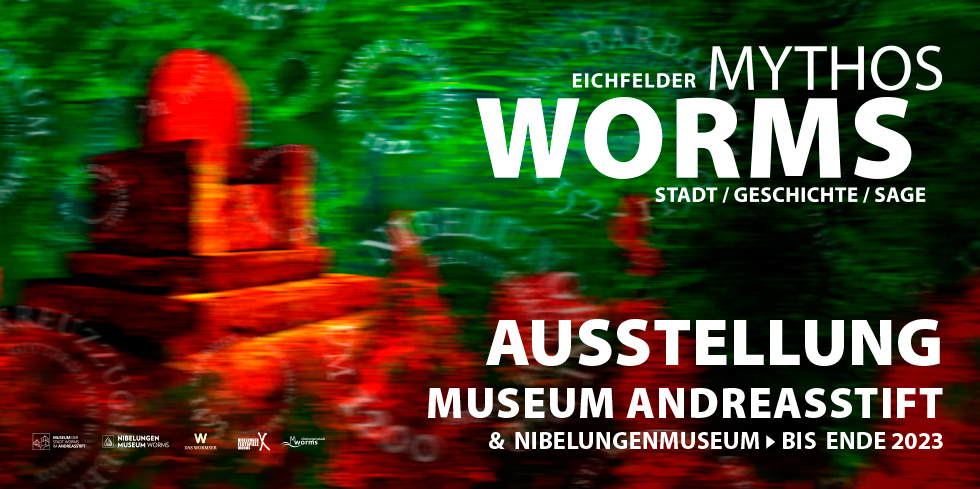Vortrag von Dr. Ellen Bender am 14. September 2023 anlässlich der Präsentation von Eichfelders „MYTHOS WORMS. Stadt/Geschichte/Sage“
Einen Vortrag über den Burgunderkönig Gundahar bzw. Gunther zu halten, ist ein Wagnis. Die Herausfor-derung besteht darin, eine Darstellung zu bieten, in welcher die Sage vom Burgundenuntergang mit der Diskussion um ihre historische Basis in Verbindung gebracht wird.
1. Die historischen Grundlagen: Das sind die antiken Quellen
Gegenstand meines Vortrags ist zunächst ein Name: Burgunder! Wo und wann taucht dieser Name auf? Die Erstnennung der Burgunder finden wir bei dem römischen Schriftsteller Plinius dem Älteren; er starb 79 n. Chr. Plinius sieht die Burgunder im 1. Jh. n. Chr. auf der Wanderung von der Ostsee und von Polen in das Rhein-Main-Mosel-Gebiet [i]. Es sind also Ostgermanen. Auf ihren Beutezügen plündern sie zusammen mit Vandalen und Alemannen römische Truppenkassen. Bei den Rheinübergängen seit dem 3. Jahrhundert wurden ihnen römische Schätze wieder abgejagt und gingen verloren. Die Erinnerung daran halten sie in ihren Sagen fest.
In der neueren Forschung spricht man davon, dass es kleinere burgundische Truppenverbände am nördlichen Oberrhein im 5. Jahrhundert gegeben habe. Man solle hier besser nicht von einem Volk der „Burgunder“ sprechen, sondern von (lat.) Burgundionen, die unter der Führung ihres Königs in Gallien siedelten.
Von Orosius (385-418), einem spätantiken Historiker, erfahren wir in einer literarischen Weltgeschichte: „Dafür, dass sie starke und gefährliche Truppen hatten, zeugten sie heute (also um 417/418), da sie sich nämlich in Gallien festgesetzt hatten.“ [ii]
Bei der Historikerin Laetitia Boehm [iii] tritt die Vermittlerrolle der Burgunder zwischen der romanischen und germanischen Welt in den Vordergrund. 369 führte nämlich der römische Kaiser Valentinian I. (364-375) mit Königen, „reges“, der Burgunder Bündnisverhandlungen, was vermuten lässt, dass die Burgunder mehrere (Klein-) Könige hatten. Ob diese zu einer oder mehreren Königsfamilien gehörten, ist nicht auszumachen. Sie wurden Foederati der Römer genannt. Bekannt ist eine Inschrift um 400 aus dem römischen Trier, laut der einem (20-jährigen) kaiserlichen Leibwächter namens Hariulfus, dem Sohn des Hanhavaldus, „aus dem königlichen Stamm der Burgunden“(„Hariulfus Protector domesticus filius Hanavaldi regalis gentis Burgundionum vlexit viginti annos et mensis nove et dies nove Reutilus avunculus sis fecit“), der vielleicht am Trierer Kaiserhof und im römischen Heer Karriere machte, das Grabmal gesetzt wurde: „Hariulf, kaiserlicher Leibgardist, Sohn des Hanavald aus dem königlichen Geschlecht der Burgunden, hat 20 (viginti) Jahre und 9 Monate und 9 Tage gelebt. Reutilo, sein Onkel (avunculus) hat (die Grabinschrift) gesetzt.“ Der Hariulfus-Grabstein befindet sich heute im Rheinischen Landesmuseum in Trier; eine Kopie des Grabsteins ist im Besitz der Andreaskirche in Worms. Den Burgunder Hariulfus können wir also mit diesem Zeugnis archäologisch nachweisen. Die Rangbezeichnung „regalis“ ist strittig: Sie könnte mit ‚fürstlich‘ oder ‚königlich‘ wiedergegeben werden. Vielleicht war ihr mit dem Namen „Burgundionen“ verbundenes Königtum ein identitätsstiftendes Element in Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen? [iv]
Die ostgermanisch-skandinavische Herkunft der Burgunder („Skandinavienthese“) fand eine gewisse Stütze im Namen der dänischen Insel „Bornholm“, deren alter Name Burgundarholmr lautete und deren Bewohner in der altenglischen Bearbeitung des Orosius Ende des 9. Jahrhunderts Burgendas genannt wurden. [v] Doch eine Übereinstimmung des Inselnamens mit dem Namen des Volkes ist nicht zu beweisen.
2. Die Burgunder am Rhein (413-436)
Die Burgunder verbündeten sich, wie oben genannt, mit Kaiser Valentinian I. 369 gegen die Alemannen, mit denen sie ständig in Streit lagen, insbesondere in dem Gebiet zwischen Taunus und Neckar. Orosius sprach von 80.000 Bewaffneten (armati), die sich am Ufer des Rheins niederließen: „Burgundionum LXXX [octoginta] ferme milia, quod nunquam antea, ad Rhenum descenderunt“.[vi] Doch als die burgundischen Truppen an den Rhein vorrückten, wo der Kaiser mit dem Bau von Befestigungen beschäftigt war, beunruhigten sie offenbar die Römer.
Um die Jahreswende 406/407 erkämpfte eine Völkerlawine von Goten, Vandalen, Alanen, Sueben den Durchbruch der Rheingrenze, plünderte und verwüstete Gallien.
Nach den Zeugnissen des lat. Kirchenvaters Eusebius Hieronymus (geb. 348, gest. 420 in Bethlehem) und des Orosius hatten sich auch Burgunder dem Zug angeschlossen und waren ebenfalls über den Rhein gezogen. Hieronymus hat diese Völkerlawine ausdrücklich in seinen Epistolae (123,15) geschildert.
Eine zweite Notiz, diesmal in der Chronik des Prosper Tiro von Aquitanien zu 413, spricht dann von der Ansiedelung der Burgunder in der Nähe des Rheins: „Burgundiones partem Galliae propinquam Rheno optinuerunt“ [vii], und zwar jetzt als Verbündete (foederati) der Römer, die sich verpflichteten, die Rheingrenze zu sichern. Kaiser Honorius nahm sie in das römische Imperium auf – als Bollwerk gegen andere germanische Stämme. Spätestens bei seinen Kriegsvorbereitungen gegen die Franken dürfte der römische Feldherr Aëtius eine taktische Allianz mit dem Burgunderkönig eingegangen sein (zum Schein?). Man muss von einer etwa zwei Jahrzehnte dauernden burgundischen Besetzung eines längeren Abschnitts der Rheingrenze ausgehen – Ob es den sagenhaften Burgunderhof in Worms gab, bleibt allerdings ein Rätsel.
Mit der Notiz über die Ansiedelung am Rhein schien die aus dem Nibelungenlied bekannte Lokalisierung der Burgunder am Rhein gesichert zu sein.
Die traditionelle Deutung eines „Burgunderreiches am Rhein“ wurde grundsätzlich seit den 1920er Jahren, u.a. von dem belgischen Historiker Henri Grégoire in Frage gestellt: Die Nibelungen seien die Leute von Nivelles!? Es gibt auch die Niederrhein-These, die dann aber von Peter Wackwitz und Karl Friedrich Stroheker widerlegt worden ist, ebenso die Nideggen-, Zülpich- oder Soest-These des Dietrich-von-Bern-Forums – alles Orte, die mit der Thidrekssaga in Verbindung gebracht werden.
Nach neuestem Forschungsstand der Mainzer Archäologen Ronald Knöchlein und Gerd Rupprecht (2005) wird von der Lokalisierung am nördlichen Oberrhein ausgegangen, wenn auch oft mit der Einschränkung, dass diese Lokalisierung sehr wahrscheinlich, aber letztlich nicht vollständig archäologisch beweisbar sei.
Patrick Jung [viii] führt eine Mainzer Truppenliste von 420/30 an und kommt zu dem Ergebnis, dass es berechtigte Hinweise auf kleinere burgundische Verbände im Raum Mainz-Worms im 5. Jahrhundert gäbe. Eine erneute Untersuchung der zweiten Bebauungsphase des spätantiken Kastells Alzey (Alteium) lässt für den Archäologen Jürgen Oldenstein den Schluss zu, dass die Burgunder als Foederaten der Römer die Grenzverteidigung mit charakteristischen organisch gedeckten Fachwerkbauten übernahmen. Es wurden Gürtelschnallen und Fibeln von „donauländischem Charakter“ gefunden sowie Glasperlen, Keramik, Kämme, die eine Zuweisung an Ostgermanen erlaubten. Weiterhin nennt Patrick Jung die Neubewertung von altbekanntem Material wie der Grabfunde aus Wolfsheim/Kreis Bingen aus dem 5. Jahrhundert – sowie, ganz aktuell, der „Wiesbadener Fibeln“ [ix]: Es handelt sich um Bronzefibeln aus dem Gräberfeld von Wiesbaden-Erbenheim von 433, die Swilcza in S-O Polen – östlich von Krakau – zuzuweisen sind.
Die Phase der Burgunder am Oberrhein endete mit ihrer Niederlage 436, sozusagen mit ihrem Untergang, der literarisch allerdings am Hof des Hunnenherrschers Etzel im Nibelungenlied gestaltet worden ist.
Welche Konstellation führte zum Fehlverhalten des Burgunderkönigs?
Archäologische Befunde verweisen auf einen starken Einfluss der von Osten anrückenden Hunnen bei den Burgundern. Übrigens hatte auch der römische Heermeister Aëtius jahrelang als Geisel am hunnischen Hof gelebt. Allem Anschein nach waren zwischen 425 und 439 die hunnischen Reitersöldner die Garanten der in Gallien erfochtenen römischen Siege. [x]
Und es mag wohl der hunnische Druck gewesen sein, der die rheinischen Burgunder unter ihrem König Guntar/Gundiharius veranlasst haben könnte, in die benachbarte Provinz Belgica vorzurücken. Die Westexpansion in die Belgica galt aber den Römern als Aufstand der burgundischen Foederaten („Burgundiones qui rebellaverant (rebellierten) a Romanis duce Aëtio debellantur“) (wurden besiegt) (= Hydatius zum Jahr 435) -, ein sicherer Hinweis auf ihre Unzuverlässigkeit in den Augen der Römer. Der Heermeister Aëtius sah in dem Verhalten des Königs Gundahari einen Vertrags- und Treuebruch. Und wohl deshalb hat er ihn durch seine hunnischen Hilfstruppen prügeln lassen.
Der spätantike Schriftsteller Prosper Tiro (um 390 bis nach 455) schreibt in seiner Chronik über den Untergang der Burgunder: „Zu jener Zeit (436) bekämpfte der Römer Aëtius den Gundicharius Burgundionum rex, also den König der Burgunden, der im Gebiet von Gallien ansässig war. Er warf ihn im Krieg nieder und gewährte ihm auf seine Bitte Frieden, den dieser jedoch nicht lange genoss, weil ihn die Hunnen mitsamt seinem Volk „ab stirpe“ (‚mit Stumpf und Stil‘) vernichteten“: „Eodem tempore Gundicharium Burgundionum regem intra Gallias habitantem Aëtius bello obtrivit pacemque ei supplicanti dedit, qua non diu potitus est, siquidem illum Chuni cum populo suo ab stirpe deleverint.” [xi]
Das Königsgeschlecht des Gundicharius war vernichtet. Das ist der berühmte Burgundenuntergang, der von Prosper letztlich den Hunnen zugeschrieben wurde und in die Nibelungensage eingegangen ist. Und als König der Burgunden wird Gundicharius genannt. Allerdings waren es nach der Chronica Gallica von 452 und der Chronik des Hydatius (394-468) nicht die Hunnen, sondern Aëtius selbst, der „fast das ganze Volk der Burgunder mit dem König“ vernichtete. Zu unterscheiden sind nach Prosper und Hydatius mindestens zwei Kämpfe, die 435 und 436 stattgefunden haben. Die beiden widersprüchlichen Nachrichten sind wohl so auf einen Nenner zu bringen, dass der Sieg über die Burgunder dem Aëtius und seinen hunnischen Soldtruppen zuzusprechen ist. Die Chronica Gallica vermeldet zu 436 die Vernichtung „fast des gesamten Volkes mitsamt dem König“, aber einige Zeilen weiter heißt es zu 443: Den Resten der Burgunder wird die Sapaudia zur Ansiedelung mit den Einheimischen gegeben.
Mit der Ansiedelung im Raum des Genfer Sees und an der Rhône beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Burgunder, nämlich das „Burgunderreich an der Rhône“ (443-532/34).
3. Der Name des burgundischen Königs
Nach dem Übergang über den Rhein wird Guntiarius als ‚phylarchos‘ bezeichnet, was Stammeshäuptling, aber auch König bedeuten kann (Olympiodor). 435 wird dann Guntiar rex als rex Burgundionum genannt.
Der spätere König Gundobad (473-516) des Rhônereiches nennt in der ‚Lex Burgundionum‘, einer Sammlung der burgundischen Stammesrechte/Gesetze, vor 501 abgefasst, die Namen seiner Vorgänger als burgundische Könige. Er bezeichnet sich selbst als Nachfolger der Burgunderkönige Gibica, Godomarus, Gislaharius, Gundaharius. Guntar/Gundahar[ius] ist demnach der vierte Name nach Gibica, dem erstgenannten, dem Spitzenahn der sogenannten Gibichungen[xii] in der Erbfolge. Der Name Gundahar(ius) ist also ein alter burgundischer Königsname, ein Leitname der Familie.
Nach der mittelalterlichen Nibelungensage war Gibica (Gibicho im Waltharius, Gibeche im Rosengartenlied, Gjuki in der Edda; Dankrat im Nibelungenlied) der Vater dreier Söhne. Sie heißen Godomar/Gundomar (= Gernot, Gernoz), Gislahar (= Giselher) und Gundahar/Gundichar (= Gunther, Guntharius). Der einzige aus zeitgenössischen Quellen bekannte ist eben Guntar/Gundahar (Guntiarius, Gundicharius). Selbst bei gleichzeitiger Herrschaft der Brüder wird man sie und den Vater in das ausgehende 4. bzw. beginnende 5. Jahrhundert setzen, d.h. etwa in die Zeit, aus welcher die Inschrift aus Trier stammt mit dem Namen des Hariulfus und des Hanhavaldus als Angehörige einer burgundischen Königsfamilie. Die Namen Hariulf und Hanhavald tauchen im Namensschatz der Königsfamilie der Gibichungen nicht auf-, was vielleicht ein Hinweis auf mehrere solcher Kleinkönigsfamilien ist.
Links des Rheins standen von (411)/413 bis (435)/436 die Burgunder unter Guntars Herrschaft. Eine Königsherrschaft beidseits des Rheins wird nur in der literarischen Tradition überliefert.
Etymologisch geht der Name Gundahar auf althochdeutsch gund- = Krieg, Kampf und heri = Heer, zurück. Der bei den Burgunderkönigen öfter auftauchende charakteristische Wortstamm -gund könnte auf Burgund zurückgeführt werden, könnte aber auch als Namensteil infolge verwandtschaftlicher Beziehungen erklärt werden.
Gunt-har dürfte eine Art Heerkönig gewesen sein, doch einer, der zu einer stirps regia, zu einem frühmittelalterlichen Königtum, gehörte.
Der Nachweis eines phylarchos seit 411 (Stammeshäuptling; König), eines rex Burgundionum (436), einer Königsfamilie, eines populus, d.h. eines Volkes, das auf den König hin orientiert ist („populo suo“ bei Prosper Tiro) und eines Gebietes („partem Galliae propinquam Rheno“) macht es verständlich, dass in der modernen Forschung – wohl unter dem Eindruck des Reiches Gunthers von Worms im Nibelungenlied – gelegentlich von einem „rheinischen Reich der Burgunder“ oder vom „Wormser Reich“ gesprochen wird. An diesem Sprachgebrauch muss man Kritik üben, weil es sich hier um eine Vermengung der antiken Quellen mit der literarischen Tradition des Mittelalters handelt. Dennoch: Da in der Königsliste der Lex Burgundionum die Könige Gibica, Godomar, Gislahar und Gundahar genannt werden, die in die Nibelungensage aufgenommen worden sind, scheint eine solche Lokalisierung am nördlichen Oberrhein als Herrschaftsgebiet der Burgunder gerechtfertigt. [xiii]
Und: Die oben angeführten Zeugnisse zu 1.) König, 2.) Volk und 3.) Gebiet sowie 4.) das Zeugnis des sich in der Lex Burgundionum widerspiegelnden Bewusstseins der Kontinuität der Herrschaft, einer ererbten Königsherrschaft von der Zeit der Niederlassung am Rhein bis in die Tage Gundobads um 500 gilt es festzuhalten.
Der Burgunde Gundahar gehört zu den großen Gestalten der Völkerwanderungszeit wie der Gote Theoderich und der Hunne Attila.
Die Ereignisse um die Niederlage der Burgunder – in der Verknüpfung mit der Gestalt des Hunnenkönigs Attila, der allerdings erst 453 starb – könnten schon bei den an die Rhône umgesiedelten Restburgundern in der kollektiven Erinnerung fortgelebt haben und zu Heldenliedern geformt worden sein, die dann beim Gastmahl zur Leier gesungen wurden. Haben sie die traumatische Erinnerung an den Untergang ihrer Königssippe in einem Lied bewahrt? Solche Lieder erwähnt schon Sidonis Apollinaris 461.
4. Die Landnahme der fränkischen Merowinger
In der lateinischen Heldensage des Waltharius des 9./10. Jahrhunderts werden die burgundischen Gibichungen nun zu Franken. Weshalb? Ein kurzer Blick auf die weitere Geschichte der Burgunder bringt die Erklärung.
Lyon war die Residenz des burgundischen Königs Gundobad (473 – 516) im Rhônereich. Er sah sich von einer doppelten Gefahr bedroht: im Norden durch die Franken, im Süden durch die Goten. Weder die Vermählung der Burgundin Chrodechild mit dem Frankenkönig Chlodwig noch die Friedensappelle des Ostgotenkönigs Theoderich (gest. 526)[xiv] konnten den Ausbruch des westgotisch/burgundisch-fränkischen Krieges im Jahre 500 verhindern. Das regnum Burgundiae wurde als „tributpflichtiger Besitz“ in das Frankenreich eingegliedert. Die Eroberung durch die Franken 534 hatte zur Folge, dass die Merowinger das Gebiet zwischen Dijon (lat. Divio) und Chalon (lat. Cabillonum), in welchem eine burgundische Präsenz archäologisch erwiesen ist, durch fränkische Krieger sichern ließen.
Burgundische Siedlungen wurden im 5./6. Jahrhundert mehrfach von den Franken im Zuge der Fränkischen Landnahme unterworfen. Eindeutige Siedlungs- und Grabstätten der Burgunder kennt die Ober/Mittelrheinregion nicht, wohl aber fränkische Siedlungen und Gräberfelder aus der Zeit der Merowinger. Die Zeit der fränkisch-merowingischen Landnahme hinterließ übrigens das Fürstengrab von Flonheim mit dem Fürstenschwert und am Ortsausgang von Worms-Westhofen ein großes Gräberfeld. [Ein merowingerzeitliches Gräberfeld gibt es auch bei Lampertheim.] Unsere Region zeigt eine durch viele Rheininseln geprägte „Landschaft“, in der die Franken unter ihren merowingischen Heerkönigen des 5. bis 7. Jahrhunderts eine maßgebliche Rolle gespielt haben. Das Bewusstsein burgundischer Abstammung ist im 6. Jh. in der Merowingerfamilie unter den Kindern und Enkeln Chlodwigs deutlich nachzuweisen (z.B. mit den Namen Gunthram oder G[Chl]odomar).
Die merowingischen Franken sind sozusagen die „Burgundererben“ nach deren „Verschwinden“.
So ist es wohl verständlich, dass in den Jahrhunderten nach der Eingliederung in das Frankenreich der Stoff der burgundischen Gibichungen bzw. Nibelungen auf die Franken übertragen wurde.
5. Die literarische Tradition: Waltharius–Edda-Nibelungenlied
a) Das Narrativ des Waltharius (lat.) bzw. des Waltharilieds um 930
Hier treffen wir zum ersten Mal auf einen König Gunther von Worms in der literarischen Welt.
Der Waltharius ist eine lateinische Heldendichtung, in Hexametern verfasst, die um 930 aufgezeichnet wurde. Das Lied gehört zu einem frühen Überlieferungsstrang der Nibelungensage; es knüpft an die großen Gestalten des Nibelungenstoffes an: an Gibich, den Vater König Gunthers sowie an Hagen und Attila.
Kurz zum Inhalt: Attila bedroht auf seinen Feldzügen die Völker Westeuropas. Damit sich die Hunnen zurückziehen, geben der fränkische, burgundische und westgotisch-aquitanische Herrscher Geiseln und Schätze als Tributzahlungen.
Der Frankenkönig Gibicho muss seinen Königsschatz als Tributzahlung für seinen Sohn an den Hunnenkönig abtreten sowie seinen Gefolgsmann Hagen als Geisel (Waltharius, V. 116 ff.). Als der Frankenkönig Gibicho stirbt, flieht Hagen vom Hunnenhof. Nach dessen Flucht versucht Attila den Westgoten Walther fester an sich zu binden. Doch Walther hat sich in Hildegunde verliebt und beschließt die Flucht mit ihr und einem Teil der königlichen Schätze. Der Plan gelingt. Walther und Hildegunde gelangen unentdeckt bis zum Rhein.
Verse 430,1-4:
Ipso quippe die, numerum qui clauserat istum,
Venerat ad fluvium iam vespere tum mediante,
Scilicet ad Rhenum, qua cursus tendit ad urbem
Nomine Wormatiam regali sede nitentem. [xv]
Übersetzung:
„Selbigen Tages erreicht er [der Held Walther], als schon der Abend hereinbrach, Endlich des Rheines gewaltigen Strom, just wo er den Lauf nimmt, Nämlich hin gen Worms, zur Stadt, Des Königs strahlendem Hochsitz.“ [xvi]
Der Frankenkönig Guntharius erkennt die Gelegenheit, Teile des Schatzes zurückzugewinnen. König Gunther sagt: „Jenen Schatz, den Gibich gezahlt dem König des Ostens, Hat nun zurück in mein Reich hierher der Allmächt’ge gesendet.“ [xvii]
Mit seinen fränkischen Gefolgsleuten samt Hagen eilt er Walther hinterher. Es kommt zur Schlacht an einem Ort, der im Waltharius Vosagum heißt. Walther macht ein letztes Verhandlungsangebot. Er bietet hundert Armreife aus dem Schatz. Doch Gunther lehnt ab. An dem engen Gebirgspass in den Vogesen, im Nibelungenlied Waskenstein genannt, verliert Walther im Kampf die rechte Hand, Gunther ein Bein und Hagen das rechte Auge. [xviii]
„Als es zum Ende nun kam, trug jeder die Zeichen des Kampfes: Hier lag Gunthers Bein, des Königs, dorten die Rechte Walthers, und wiederum dort Held Hagens zuckendes Auge. So teilten sie untereinander die hunnischen Spangen.“ [xix]
Endlich zeigt sich Guntharius versöhnungsbereit: Sie teilen sich den Hort mit den „avarischen Spangen“ und schließen Frieden (1404).
Welche Konstellation führte zum Konflikt des Guntharius?
Worms ist der Königssitz des Guntharius, des Sohnes von Gibicho (Waltharius Vers 13-16; 116 f.; 433). Die Gibichungen sind jetzt Franken! Guntharius ist kein Burgunder, sondern Frankenkönig. Die Dichtung zeichnet einen habgierigen König.
Der Konflikt mit den Hunnen wird auf Goldgier reduziert, nämlich auf den Königsschatz, den sich Guntharius im Kampf gegen Walther zurückholen will.
Der königliche Schatz gehörte bei den germanischen Volksstämmen des 5./6. Jahrhunderts wie den Westgoten, Ostgoten, Avaren, Gepiden und Vandalen zur Herrschaft; er verleiht Macht. Im germanischen Denken sind Reichtümer aus Gold und Silber die Grundlage der Königsgewalt.
b) Die mythischen Erzählungen der älteren Lieder-Edda (um 1270)
Die Sage vom Untergang der Gibichungen bzw. Nibelungen hat Erzählungen in der Edda ausgebildet, die den Rhein(!) als Handlungsort definieren.
In dem um 900 entstandenen Alten Atlilied der Lieder-Edda wird der Untergang der Nibelungen mit der Gestalt des Hunnenkönigs Attila/Atli verknüpft.
Der Hunnenkönig Atli, mit Gudrun (im NL: Kriemhild), verheiratet, will den „Hort der Niflunga“ [xx] für sich allein besitzen. Er lädt die Nibelungen Gunnar und Högni (im NL: Gunther und Hagen), die Brüder Gudruns und Söhne Gjukis, – deshalb Gjukungen genannt -, die von des „Rheines Rotgebirg“ (17,5: „rosmufjöll Rínar“) kommen, hinterlistig an seinen Hof. Bevor Gunnar und Högni die Einladung annehmen, verstecken sie jedoch den Goldschatz im Rhein.
Den verborgenen Königshort verraten die Nibelungen Gunnar und Högni nicht. Atli mordet die Könige grausam. Er schneidet Högnis Herz aus dem Leib und wirft Gunnar in den Schlangenhof.
„So wird vernichtet der Niblunge
mächtiger Stamm.“ [xxi]
Der „Hort der Niblunge“ ist also in der Atlakvida der alte, umstrittene Königshort des Stammes. Und wo ist der mythische Goldschatz verborgen? Im Alten Atlilied im Rhein: „Nun hüte der Rhein…den göttlichen Schatz der Niblunge!“ (28,1f.), ruft Gunnar, als er das Herz des toten Högni sieht. Der Gunnar der Edda geht als letzter seines Stammes standhaft in den Tod.
c) Das Nibelungenlied um 1200
Ist das Verhalten des nordischen Gunnar oder des fränkischen Guntharius Vorbild für die Gestalt Gunthers im Nibelungenlied?
Das Nibelungenlied ist im Mittelalter wohl die wichtigste literarische Verarbeitung des Narrativs von den Burgunden bzw. ihres Untergangs. Es wird in der geschichtswissenschaftlichen Literatur als eines der Hauptargumente für die Lokalisierung der burgundischen Königsfamilie am nördlichen Oberrhein herangezogen. Es situiert den Hof der Burgunden in Worms, wo die drei Söhne Dankrats (statt Gibichs), Gunther, Gernot, Giselher und deren Schwester Kriemhild leben (NL 2, 4-7). Im Nibelungenlied ist Gunther der älteste Bruder am burgundischen Königshof und Vormund (munt) Kriemhilds
Der Erzähler stellt ihn an als vollendeten Repräsentanten des Wormser Hofes vor, und zwar mit idealtypischen Herrschereigenschaften ausgezeichnet: edel, rîch, lobelîch (4,1 f.), sehr kraftvoll und tapfer (5,2).
Aber es stellen sich erste Zweifel an der Kühnheit und dem Kampfesmut des Königs ein, als dieser nämlich von Siegfried bei dessen Ankunft in Worms zum Zweikampf herausgefordert wird.
Die folgenden Beispiele zeigen, dass Gunther vor den Anforderungen, die an ihn gestellt werden, zurückweicht. Er ist ein Herrscher, der Konflikten möglichst diplomatisch aus dem Weg geht, sie aussitzt oder aber versagt.
1. Beispiel: Gunthers Reaktion auf Siegfrieds Herausforderung.
Als Siegfried von Xanten an den Königshof nach Worms kommt und König Gunther auffordert, mit ihm um die Herrschaft über Burgund zu kämpfen (NL B 113), weist ihn der Familienclan der Burgunden, insbesondere Gernot, in seine Schranken. An Gunther prallt Siegfrieds Herausforderung ab. Gunther beruft sich auf sein ererbtes Königtum über Länder, die er rechtmäßig beherrsche: “Wie het ich daz verdienet“, sprach Gunther der degen, „des mîn vater lange mit êren hât gepfleget, daz wir daz solden vliesen von iemannes kraft?“ (112,1-3). Der König verhält sich diplomatisch geschickt: „Seid mein Gast und teilt die Herrschaft über diese Reiche mit mir.“ [xxii] Damit beendet er den Auftritt Siegfrieds.
2. Beispiel: Sachsenkrieg
Während König Gunther über die Fehdeansage der Dänen und Sachsen klagt und um Bedenkzeit bittet (B, 147,1: „Nu bîtet eine wîle“), zeigt Siegfried Kampfesmut und Führungsqualität. Gunther erscheint hier als ein bei Konflikten ratloser Landesherr.
3. Beispiel: Betrügerische Brautwerbung
Durch die Ehe mit Brünhild von Isenstein will König Gunther von Burgund seinen Machtbereich erweitern. Er ist getrieben von der Begierde nach der Frau. B, 329,3-4:
„ich wil durch ir minne wâgen mînen lîp:
den wil ich verliesen, sine werde mîn wîp.“
„Um ihrer Liebe willen setze ich mein Leben ein.
Ich bin bereit, es zu verlieren, wenn sie nicht meine Frau wird.“
Da der Werber Gunther bei der Freierprobe auf Isenstein in der kraft-Probe unterlegen wäre und somit von Brünhild getötet würde, ist er auf Siegfrieds Hilfe angewiesen. Die Männer inszenieren vor der Königin ein Betrugsmanöver. Gunther erringt durch Betrug an der Dame Brünhild diese zur Ehe und gewinnt Macht, nämlich die Herrschaft über ihr Land und Volk.
Aber Brünhild verweigert ihm den Beischlaf: „die minne si im verbot“ (B, 637,3) (= verweigerte). Der König unterliegt physisch Brünhilds übermäßiger Stärke und muss die Hochzeitsnacht, an einen Nagel gehängt, an der Wand verbringen. Da Gunther versagt, muss ihm Siegfried erneut durch Täuschung helfen.
4. Beispiel: Gunthers Scheitern bei der rechtlichen Regelung des Frauenstreites.
Die burgundische Königin wird durch Kriemhilds Vorrangdemonstration beim Streit vor dem Wormser Dom öffentlich beleidigt. Sie verlangt von Gunther die Wiederherstellung ihrer Würde. Der König ist gezwungen, vor aller Augen zu handeln: Als Brünhilds Ehemann muss er für sie, die unter seinem Schutz steht, die Anklage gegen Siegfried erheben. Gunther lädt Siegfried vor das Königsgericht (B, 855), Siegfried als Beklagter erscheint (856). Gunther bringt die Klage vor (857). Siegfried weist sie zurück und bietet als Beweismittel den Eid an (858-860). Er hebt die Hand zum Schwur (860,1), mit dem er die Behauptung seiner Frau, er habe als erster mit Brünhild geschlafen, zurückweist (857). Der Ring der Männer tritt zusammen, um den Eid rechtsgültig werden zu lassen (859,4). Da bricht Gunther das Verfahren ab und erklärt Siegfried für unschuldig (860,2-4). Es handelt sich um ein unzulängliches Gerichtsverfahren. Gunther bewirkt durch sein Zurückweichen einen unbefriedigenden Ausgang des Prozesses, was sich an der Betroffenheit der Umstehenden und an Brünhilds Weinen ablesen lässt: „dô trûret alsô sêre der Prünhilde lîp, daz ez erbarmen muose die Guntheres man.“ (863,2 f.). Das emotionale Signal des Weinens der Königin fordert unmissverständlich ein Eingehen auf den Konflikt. Der burgundischen Königin musste an einer klaren und von Siegfried beeideten Beseitigung des Verdachts gelegen sein. So bedeutet das Zurückweichen des Herrschers vor dem Reinigungseid, dass er auf ausreichende Genugtuung für Brünhild verzichtet. Nach einer so schweren Kränkung fordert Brünhild die Bestrafung des Beleidigers ihrer Ehre. Und es ist Hagen, der die ‚Bestrafung‘ Siegfrieds durch Ermordung durchführt: „dô het gerochen Hagene harte Prünhilde zorn“(1013,4). Diese Blutrache, also Rache durch Tötung, verurteilt der Dichter als Verrat und Bruch aller Bindungen. [xxiii]
5. Beispiel: Gunthers Leugnen bei der Bahrprobe und die betrügerische Versöhnung mit der Schwester.
Siegfried stand als Gast im Schutz des Gastgebers Gunther. So wäre Gunther als Gastgeber, als Schwager, Familienoberhaupt und König unbedingt verpflichtet, das Verbrechen der Ermordung Siegfrieds zu sühnen. Gunther hätte den Täter Hagen für den Siegfriedmord bestrafen müssen! Aber er unternimmt nicht das Geringste, das Unrecht zu tilgen. Ein Gerichtsverfahren kommt in Ansätzen allein durch Kriemhilds Initiative in Gang. Als Gunther und Hagen zu den Trauernden treten, weist sie Gunthers scheinheilige Beileidsäußerungen zurück: „Waer‘ iu dar umbe leide, so’n waer‘ es niht geschehen.“ (B, 1042,1): „Täte euch Siegfrieds Tod leid, wäre die Tat nicht geschehen.“ Als er lügt („Dir ist von meinen Leuten kein Leid zugefügt worden“: C,1055,1), führt sie die Bahrprobe durch. Die Bahrprobe macht die Schuld Hagens offenbar, als er an die Bahre tritt und die Wunden des Leichnams zu bluten beginnen: Der Tote überführt sozusagen den Mörder. Und König Gunther lügt, als er sagt: „Räuber erschlugen ihn. Hagen hat es nicht getan“ (B,1045,4; C,1057,4). Kriemhild aber durchschaut die Zusammenhänge: „Die Räuber kenne ich gut… Gunther und Hagen, ja, ihr habt es getan.“ (C, 1058).
Weiter zeigt sich Gunthers Fehlverhalten bei der sog. „Versöhnung“ mit Kriemhild viereinhalb Jahre nach Siegfrieds Ermordung. Hagen betreibt die geschwisterliche Versöhnung, damit die Witwe Kriemhild ihre Morgengabe, den sagenhaften Nibelungenschatz, nach Worms holt. C, 1118: Eines Tages aber sprach Hagen zum König: „Könnten wir erreichen, dass ihr euch mit eurer Schwester versöhnt, dann käme das Nibelungengold in dieses Land. Wir hätten also großen Vorteil davon, wenn uns die Königin wieder freundlich gesonnen wäre.“ Die angestrebte Versöhnung soll der Konfliktbeilegung dienen, ist aber nur Mittel zum Zweck, nämlich zur Hortgewinnung. Die Versöhnung mit der Schwester entpuppt sich als eine betrügerische Schein-suone: „Niemals war eine so tränenreiche Versöhnung mit solcher Falschheit vergiftet“, kommentiert der Erzähler der Handschrift C die Szene: „Ez enwart nie suone mit so vil trähenen me/ mit valsche gefuoget. ir tet ir schade we;/“ (C, 1128,1-2).[xxiv] Denn durch Gunthers Mitschuld wird ihr, Kriemhild, der unermessliche Schatz aus Habgier von Hagen geraubt. Damit steht als zweites ungesühntes Verbrechen des Königshofes fest: Raub der morgengâbe einer Witwe, die zudem Schwester derer ist, die den Raub hätten verhindern können. Dem König geht es nicht um die Vergeltung des Unrechts, sondern um Konsolidierung seines Königtums: um seinen Machterhalt!
6. Beispiel: Gunthers Verletzung der Fürsorgepflicht für Kriemhild als König und Vormund.
Wie nimmt Gunther die Fürstentugend der Schutzpflicht wahr? Die Witwe bleibt ja wegen dieser Schutzpflicht bei den Verwandten in Worms. Gunther hätte der wieder unter seiner Vormundschaft Stehenden Schutz und Hilfe anbieten können, wie es Giselher und Gernot zunächst tun (1049; 1078-1082). Aber Gunther unternimmt nichts.[xxv] Und obwohl er sich seiner Verpflichtung bewusst ist und ihr, wie er sagt, nachkommen will (B, 1131,3: „und wil ez fürbaz hüeten: (= darauf Acht haben) si ist diu swester mîn“), lässt er doch den Schutz für die Schwester und Witwe vermissen, als Hagen den Hortraub vorbereitet. Giselher und Gernot sind zwar empört, tun aber auch nichts dagegen, weil Hagen ein Verwandter, ein mâc, ist. Eindringlich erinnert Kriemhild an ihr Recht auf Schutz durch die Brüder. Sie klagt vor Giselher. B,1135, 1 f.:
„vil lieber bruoder, du solt gedenken mîn.
Beidiu lîbes unde guotes soltu mîn voget sîn.“
„Mein lieber Bruder, du solltest an mich denken,
mein Leben und meinen Besitz solltest du beschützen.“
Giselher vertröstet die Schwester auf später: „Das will ich tun, wenn wir wiederkommen; jetzt müssen wir fortreiten“ (C, 1149, 3 f.). In der Zwischenzeit raubt Hagen der Witwe den Schatz und versenkt ihn bei Lôche in den Rhein. Als Kriemhild ihren Schaden beklagt, bedauern die königlichen Brüder die Tat, bestrafen Hagen aber nicht (1154 f.).
7. Beispiel: Gunthers Fehleinschätzung der Kriegssituation
Gunther erweist sich beim Zug ins Hunnenland als König und Ritter unfähig, sein Volk und sein Heer in der dem Gebieter zukommenden Weise zu schützen und zu lenken.
Bei der Ankunft am Hunnenhof warnt Dietrich von Bern die Burgunden vor der drohenden Gefahr. Er berichtet Gunther von Kriemhilds anhaltender Trauer und ihren Racheabsichten. Gunther ignoriert die Warnungen: „Warum soll ich mich in Acht nehmen?“ sprach der erhabene König Gunther. „Etzel hat uns Boten gesandt, damit wir zu ihm in sein Land kommen, weshalb soll ich da weiter nachfragen?“ (C, 1767, 1-3). Kriemhild allerdings hält ihre Feindschaft gegen Hagen und Gunther nicht verborgen. Sie macht deutlich, dass der Rechtsbruch noch immer ungesühnt und die Rachepflicht für sie elementar ist: „Ein Mord und zwei Raubüberfälle haben mich getroffen; für die suche ich Arme noch wohltuende Vergeltung.“ (C, 1785,3-4). Das ist klar an Gunthers und Hagens Adresse gerichtet.
Gunther aber schätzt die Lage falsch ein – aus Mangel an Weitsicht und Urteilskraft. Er führt sein Heer gegen die Hunnen in den Untergang, obwohl er doch mehrfach gewarnt wurde. Die Vernichtung des burgundischen Heeres kann als Folge des Fehlverhaltens seines Königs gesehen werden.
Ein entscheidender Punkt der Kritik an König Gunther im Nibelungenlied ist sein Versagen als rex justus, als Anwalt des Rechts und damit die Kritik an seiner „Konfliktregelung“.
Vor allem am Misslingen der Rechtsprechung im Königinnenstreit, der Anstoß des Untergangs ist: „von zweier vrouwen bâgen wart vil manic helt verlorn“ (876,4), entzündet sich die Kritik an Gunther. Der König hätte beim Königsgericht entschlossen für ein geregeltes Gerichtsverfahren zur Konfliktbeilegung eintreten müssen. Stattdessen nimmt er Betrug und Rechtsbruch in Kauf.
Es zeigt sich, dass Gunther den Anforderungen nicht genügt, die an einen rex justus et pacificus gestellt werden, also an einen mittelalterlichen Herrscher, der der Gerechtigkeit und dem Frieden verpflichtet ist. Der Machthaber Gunther steht ganz im Schatten seines Beraters Hagen, der mit dem Verbrechen an Siegfried die Handlungsfäden zieht und die Entscheidungen des Königshofes dominiert. Der König ist ein Regent ohne Führungskompetenz. Gunther fehlt die Autorität des Rechts.
Schon im Gesetzbuch Gundobads, der ‚Lex Burgundionum‘ um 500, wird die gesetzgebende Gewalt des Königs unterstrichen. „Der König macht seine Rechtsentscheidungen verbindlich und gibt ihnen Gesetzeskraft.“ Auch wird in den burgundischen Stammesgesetzen der Strafprozess durch ein Verfahren ersetzt, das auf dem Eid als Zeugnis der Gruppenloyalität und auf dem Zweikampf als Ersatz für die Blut-Rache (= Rache durch Tötung) beruhte. Beides, Reinigungseid und gerichtlicher Zweikampf werden noch unter Karl d. Gr. als Besonderheiten der Eidesleistung erwähnt. Aber beim Königsgericht weicht Gunther vor Eidesleistung und gerichtlichem Zweikampf zurück. Seine Schuld wäre offenbar geworden. Und er hätte einen Zweikampf austragen müssen, den er nicht gewinnen konnte. Das fragile Reich steuert unter Gunther dem Untergang am Hunnenhof zu, wo alle Nibelungen sterben müssen. Somit ist das Versagen des Königs Ursache für den Untergang seines Reiches.
Fazit
Das Burgunderreich – historisch gesehen – gilt als Beispiel einer gescheiterten, schließlich den Franken erlegenen germanischen Reichsgründung auf dem Boden des Imperium Romanum, vergleichbar anderen Ostgermanenreichen wie denen der Goten in Spanien oder der Langobarden in Italien.
Auf der anderen Seite ist ein Königtum der Burgundionen am Rhein – literarisch gesehen – im kollektiven Bewusstsein bis in die Gegenwart lebendig geblieben, weil sein Untergang in der Nibelungensage erzählt wird.
Exkurs: Die bedeutende Rolle von Worms
Das Wort „Wormez/Wormze“ kommt in der Hs. B des Nibelungenlieds 32-mal vor (und zwar im 1. Teil allein 23-mal; in der Hs. C mind. 36-mal.) Die Stadt ‚Worms‘ hat also Gewicht in der Dichtung als literarischer Schauplatz!
Warum wird Gunthers Hof gerade in Worms verortet? Und warum steht Worms im Mittelpunkt des burgundischen Königtums?
In der realen Welt ist es die Lage am „hochberühmten Rhein“, die ‚maxima vis regni‘, mit der Otto von Freising 1138 Worms lobt. Für die dynastische Konsolidierung und Expansion der Burgunden im 5. Jh. war die Lokalisierung ihrer Herrschaft am Rhein, einem in die Ferne kommunizierenden Flusslauf von militärisch-strategischer Bedeutung. Der nördliche Oberrhein mit Neckar, Main und Mosel bildete eine europäische Verkehrsachse, war – auf beiden Seiten – Heerweg, Verkehrsweg, Handels- und Transportweg (politische Bedeutung). Der Raum lag zentral zwischen Alemannen, Baiern, Franken, Sachsen und Burgundern; er war politischer Knotenpunkt mit N-S und O-W-Achse.
Es gab in dieser Kernlandschaft eine Kontinuität römischer und fränkischer Kultur – und seit 960 der jüdisch-aschkenasischen Geschichte (Raschi!). In unmittelbarer Nähe lag als geistiges Zentrum des Reiches Kloster Lorsch mit dem Chronisten Einhard (unter Karl d. Gr.) Der Raum hatte also auch geistig-kulturelle Bedeutung.
Die günstigen Voraussetzungen führten dazu, dass die deutschen Könige des Mittelalters eine Vorliebe für diesen Raum entwickelten. „Die königliche Vorliebe setzte in der Epoche der Karolinger ein“ (Stefan Weinfurter). Worms war die Stadt der kaiserlichen Präsenz, war beliebter Aufenthaltsort der Könige und Kaiser des Mittelalters in Kontinuität.
Das Umland konnte den königlichen Hofstaat ein ganzes Jahr lang ernähren (ökonomischer Vorteil). Unter Friedrich Barbarossa erfolgte eine Stärkung der Wirtschaftskraft der Stadt mit dem Judenprivileg von 1157 und eine besondere Würdigung mit der Dom-Weihe von 1181 sowie dem Freiheitsprivileg Barbarossas von 1184, über dem Nordportal angebracht.
Zahlreiche Hoftage wurden in Worms veranstaltet, auf denen Rechtsversammlungen und Königsgerichte abgehalten wurden, insbesondere unter Karl dem Großen und Friedrich Barbarossa.
Das Nordportal des Domes, durch welches Kaiser und Adel einzogen, ist im Hochmittelalter ein solcher Rechtsort. Auf dem Dom-Vorplatz wurden Urteile gesprochen und Urkunden gesiegelt. Der Wormser Dom als Rechtssymbol prägt das Siegel der Stadt.
Auf den Hoftagen des Stauferkaisers Friedrich I. regelten die königlichen Hofrichter Konflikte, so auf Hoftagen des kaiserlichen Gerichtshofes, allein auf 13 Hoftagen in Worms! Deshalb kann man den Königinnenstreit, der die Ereigniskette des Untergangs initiierte – die Erzählerkommentare in 6,4 und in 876,4 führen das Untergangsgeschehen ja auf den Streit zurück: [„si sturben sît jaemerlîche von zweier edelen frouwen nît“] – an diesem hervorgehobenen, öffentlichen Rechtsort vermuten.
Das alles erklärt, warum der Stadt Worms am Rhein hohe Bedeutung durch den Dichter in seinem Werk zugemessen werden konnte.
[i] Reinhold Kaiser, Die Burgunder, Stuttgart 2004
[ii] Historiae adversus paganos, in: Reinhold Kaiser, Die Burgunder, 2004, S. 21 f.
[iii] Laetitia Böhm,Geschichte Burgunds. Politik – Staatsbildungen – Kultur, 2. ergänzte Auflage, Wiesbaden 1998
[iv] Ich unterscheide zwischen dem historischen Volksnamen („die Burgunder“) und dem literarisch gebrauchten Namen („die Burgunden“).
[v] The old english Orosius, ed. Janet Bately, Oxford 1980, Bd. I, S. 16
[vi] Orosius, Historia VII, 32,11
[vii] Prosper Tiro, Chron. 1250, S. 467
[viii] www.nibelungenlied-gesellschaft.de/03_beitrag/gast/b1-12_jung.html
[ix] Horst Wolfgang Böhme, Die „Wiesbadener Fibeln“, in: Festschrift für Jürgen Oldenstein, Bonn 2012
[x] “Archaeological evidence points to a strong influence of the Huns advancing from the east among the Burgundians. Incidentally, the Roman commander Aëtius had also lived for years as a hostage at the Hunnic court. Apparently, between 425 and 439, the Hunnic cavalry mercenaries were the guarantors of the Roman victories won in Gaul.” In: Festschrift für Volker Bierbrauer zum 65. Geburtstag, Friedberg 2005 (Originalveröffentlichung in: Cum grano salis. Beiträge zur europäischen Vor- und Frühgeschichte, Max Martin, S. 237-248 Zur Entstehung des ersten burgundischen Königreiches am Rhein).
[xi] Prosper Tiro, Chron. 1322, S. 475
[xii] Lex Burgundionum c. 3, S. 43
[xiii] Reinhold Kaiser, a.a.O., S. 28
[xiv] Die Sage hat aus dem historischen Theoderich die literarische Gestalt des Dietrich von Bern werden lassen.
[xv] Waltharius Manis Fortis, 9./10. Jh., The Latin library Verse 430,1-4
[xvi] Das Waltharilied, übersetzt von Hermann Althof 1911, Verse 275-279
[xvii] Das Waltharilied, Verse 275-279; 311-312, S. 22, Blatt 428, in: Dr. Gotthold Bötticher, Hildebrandslied und Waltharilied, übersetzt und erläutert, 3. verbesserte Auflage, Halle a. d. Saale, 1894
[xviii] Das Nibelungenlied bezieht sich in den Versen 2343 f. auf diese Episode am Waskenstein, als Hagen zunächst auf seinem Schild sitzt und nicht gegen seinen Freund Walther kämpfen will.
[xix] Das Waltharilied, a.a.O., Verse 1024-1027, S. 46
[xx] Felix Genzmer, Heldenlieder der Edda, Stuttgart 1970, Atlilied 27,2; 28,2
[xxi] Im Alten Sigurdlied heißt es:
svá mun öll yður
ætt Niflunga
afli gengin,
[eruð eiðrofa.]
(Sigurðarkviða in meiri, Str. 20
= Brot af Sigurðarkviðu).
[xxii] NL Handschrift B, 127,1-3: Dô sprach der wirt des landes: „allez daz wir hân, geruochet irs nâch êren, daz sî iu undertân, und sî mit iu geteilet lîp unde guot.“
[xxiii] NL Hs. C, Strophe 884: untriuwe. Hs. B, Strophen 876: untriuwe, 906: meinraete
[xxiv] Vergleiche dagegen B, 1115,1f.: Ez enwart nie suone mit sô vil trähen mê gefüeget under vriunden. – Es handelt sich hier um die förmliche Wiederherstellung des status quo zwischen den Geschwistern („under vriunden“).
[xxv] Vgl. Roswitha Wisniewski, Das Versagen des Königs. Zur Interpretation des Nibelungenliedes. In: Dietrich Schmidtke (Hrsg.), Festschrift für Ingeborg Schröbler zum 65. Geburtstag, Tübingen 1973, S. 170 – 186, hier S. 178 f.